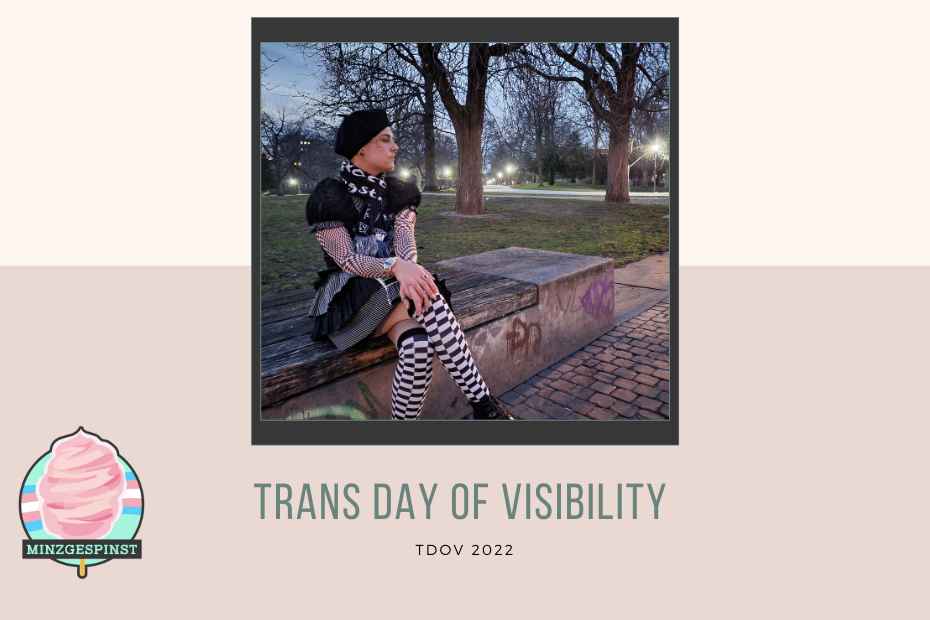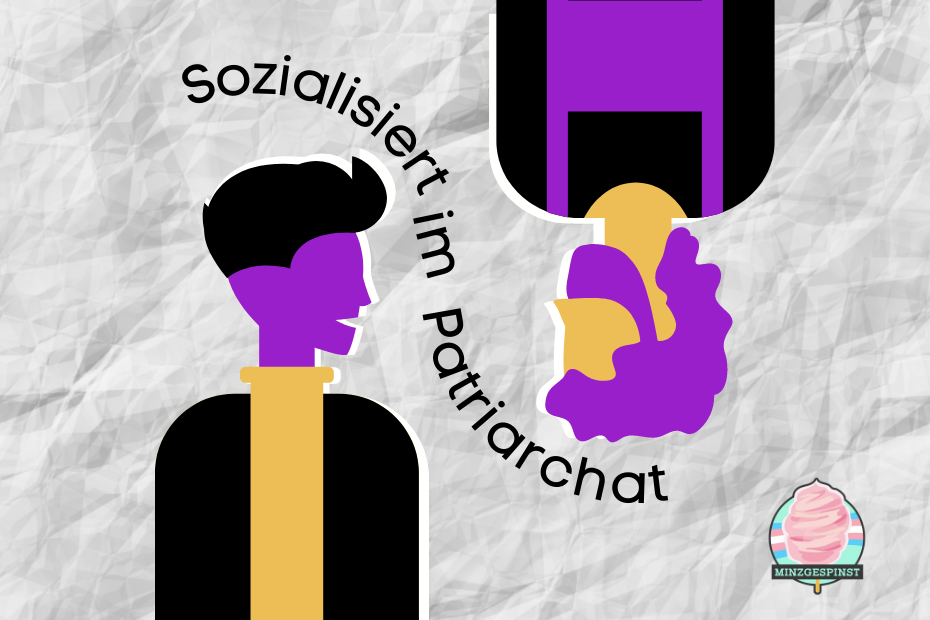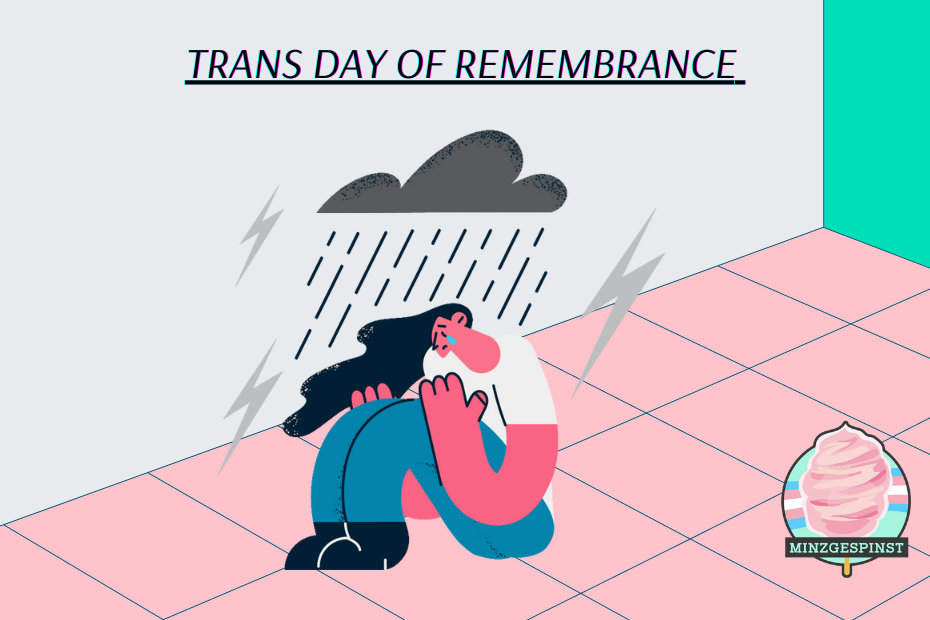„Märchenland für alle“ – Rezension
Ein Buch, das in Ungarn (seinem ursprünglichen Erscheinungsland) eine Kontroverse auslöste. Freundlich ausgdrückt. „Märchenland für alle“ würde die heterosexuelle Kernfamilie in Gefahr bringen. Bücher wurden… Weiterlesen »„Märchenland für alle“ – Rezension